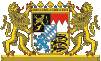Nachbericht zur Veranstaltung am 01.07.2025
Öko-Gemüsebautag 2025
Am 1. Juli 2025 lud der Gemüsebauversuchsbetrieb der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) interessierte Gärtnerinnen und Gärtner auch dieses Jahr zum Öko-Gemüsebautag auf das Versuchsgelände in Bamberg ein. Rund 100 Teilnehmende aus Beratung und Praxis folgten der Einladung, um sich über die aktuell laufenden Versuche und die neuesten Projekte und Forschungsergebnisse zu informieren.
Begrüßung im Mustergarten
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Andreas Schmitt (Arbeitsbereichsleiter Umweltgerechte Erzeugung, LWG), Lena-Maria Hohenester (Geschäftsführung LVÖ Bayern) und Florian Thurnbauer (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus) die Gäste im Mustergarten des Versuchsbetriebs. In ihren Grußworten betonten alle drei die zentrale Bedeutung des ökologischen Landbaus als Wegbereiter einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Sie würdigten die kontinuierliche Versuchsarbeit im ökologischen Gemüsebau und unterstrichen den Wert des dabei gewonnenen Wissens für die Praxis. Darüber hinaus hoben sie die Notwendigkeit eines engen Austauschs zwischen Forschung und Praxis hervor – insbesondere im Hinblick auf den Wissenstransfer und die Weiterentwicklung anbaupraktischer Lösungen.
Für das leibliche Wohl sorgte erneut ein Foodtruck, der den Teilnehmenden zur Mittagspause frisch zubereitete, vegetarische Gerichte anbot und damit auch kulinarisch die Vielfalt des Gemüsebaus unterstrich.
Rundgang durch den Betrieb
Station 1: konventionell-integrierte Versuche
Der Rundgang durch den Betrieb begann im konventionell-integrierten Betriebsteil. Martin Schulz und Bernhard Weber gaben den Teilnehmenden Einblicke in eine ressourcenschonende und rückstandsfreie Fruchtgemüseproduktion. Auch in diesem Jahr wurde der erdelose Anbau von Wassermelonen, die ein Fruchtgewicht von weniger als 2 kg erreichen sollen, weiter optimiert. Basierend auf den Erfahrungen des Vorjahres kam ein verändertes Erziehungssystem zum Einsatz: Die Pflanzen wurden nach dem fünften Blatt geköpft und anschließend zweitriebig erzogen. Durch das Einziehen eines Gitters konnte zudem die Blatt-Assimilationsfläche vergrößert werden. Die eingesetzten Hummeln erwiesen sich in diesem Jahr jedoch als unzuverlässige Bestäuber, weshalb zusätzlich von Hand bzw. mit zugekauften Schwebfliegen bestäubt wurde.
Im zweiten Versuchsgewächshaus wurden zwei regionale organische Substrate auf ihre Eignung für den erdelosen Anbau geprüft. Entscheidend für den Kulturerfolg sind eine bedarfsgerechte Bewässerung und Düngung. Hierzu werden testweise Phytosensoren der Firma Vivent eingesetzt, die mithilfe KI-basierter Modelle Hinweise auf mögliche Fehler in der Kulturführung (z. B. Klimasteuerung) geben sollen. Seit mehreren Jahren laufen in Bamberg Versuche zum Anbau von Ingwer im hydroponischen System. Aktuelles Thema ist die Prüfung einer Zweitnutzung von Holzfaser- und Kokossubstraten. Abgeschlossen wurde die Station mit der Vorstellung eines Versuchs zum Einsatz torffreier bzw. torfreduzierter Anzuchtsubstrate für die Jungpflanzenproduktion im DWC-System (Deep Water Culture).
Station 2: Öko-Versuche unter Glas und Folie
An der zweiten Station stellte Nicolas Müller den Heidelbeeranbauversuch für ursprünglich als ungeeignet geltende Standorte vor. Der Versuch befindet sich im dritten Standjahr und wird in einer Grabendammkultur durchgeführt. Ziel ist es, herauszufinden, inwieweit Heidelbeeren durch gezielte Kulturmaßnahmen auch auf weniger geeigneten Standorten in Bio-Qualität angebaut werden können. Zur Bodenvorbereitung wurden Gräben mit saurem Biosubstrat verfüllt, während aus dem Aushub Dämme geformt wurden. Dabei bleibt der Kontakt der Pflanzen zum gewachsenen Boden erhalten – ein entscheidender Aspekt für den ökologischen Anbau. Verglichen werden zwei Anbausysteme: Überdachung und Freiland. Zusätzlich wurde bei der Hälfte der Varianten Moorbeet-Mykorrhiza ins Pflanzloch eingebracht, um mögliche positive Effekte auf das Pflanzenwachstum zu beobachten.
Josef Eichhorn, Anna-Katharina Schwinn und Carola Nitsch stellten die aktuellen Versuche im geschützten Anbau sowie die Freilandtomaten vor. Ein Versuch mit Auberginen im Gewächshaus zeigt verschiedene Untersaatenmischungen an, die nicht nur der EU-Öko-Basisverordnung gerecht werden sollen, sondern auch den Nützlingen und den Bestäuberinsekten Unterschlupf und Nahrung bieten. Im ungeheizten Folientunnel werden sechs, teils neue, jordanvirusresistente Rispentomatensorten hinsichtlich des Ertrags verglichen. Auch sensorische Eigenschaften (Geschmack) werden in diesem Jahr einbezogen.
Ein weiterer Versuch im Folientunnel beschäftigt sich mit der Reife bzw. Ernteverfrühung bei Spitzpaprika. Es wurde eine Frühpflanzung mit Folien- und Vliesschutz sowie Mypex-Gewebeabdeckung am Boden mit den bereits bewährten Varianten Lochfolie und Mypex verglichen. Im hinteren Teil dieses Tunnels befindet sich ein Probesortiment unterschiedlicher Gurkengewächse: Bittergurke, Luffa (Schwammgurke), japanische Gurkensorten und die Schlangenhaargurke. Spaghettibohnen und Pepino (Birnenmelone) vervollständigen den Experimentierteil und sollen zeigen, ob sich von den genannten Arten und Sorten interessante, einfach zu kultivierende Fruchtgemüse für den Marktgärtner herausfiltern lassen. Im Freiland werden sieben gegen Kraut- und Braunfäule resistente Stabtomatensorten sowie drei ebenfalls resistente Buschtomatensorten hinsichtlich Ertragsleistung und Pflanzengesundheit miteinander verglichen.
Station 3: Öko-Versuche im Freiland Teil I
Ruben Pires Heise stellte den Versuchsaufbau des Erdbeersortenversuches vor und präsentierte die Ergebnisse der letzten beiden Versuchsjahre. In diesem jährlich durchgeführten Versuch werden neue Erdbeersorten mit etablierten Sorten verglichen, um den Betrieben Anbauempfehlungen zu geben und mögliche Berührungsängste mit noch unbekannten Sorten abzubauen. Jede Sorte wird dabei in drei Wiederholungen innerhalb einer randomisierten Blockanlage mit insgesamt 90 Pflanzen geprüft. Als nächsten Programmpunkt der Station stellte Lena Lips den N-Düngeversuch vor. Dabei werden Körnerleguminosen wie Sojabohne, Lupine und Futtererbse angebaut, um sie im darauffolgenden Jahr als geschroteten Dünger in einer Gemüsekultur einzuarbeiten. Dabei werden sie mit anderen üblichen Handelsdüngern verglichen und auf ihre N-Wirksamkeit geprüft.
Muhammad Hafeez Ul Barkat stellte den laufenden Tropfbewässerungsversuch vor, in dem verschiedene Tiefenlagen unterirdischer Tropfschläuche mit der klassischen Überkopfbewässerung sowie einer oberflächennahen Tropfbewässerung (10 cm) verglichen werden. Der Versuch läuft auf Freilandbeeten mit Weißkohl, Zucchini, Kürbis und Zuckermelone und soll Erkenntnisse zur optimalen Wasserversorgung und Nährstoffführung im ökologischen Gemüsebau liefern. Neben den Tropfschläuchen wurden auch Komponenten wie Magnetventile, digitale Wasserzähler, Düngerdosierer sowie verschiedene Filter- und Steuerungseinheiten vorgestellt. Zur besseren Überwachung der Bodenfeuchte und Wasserverfügbarkeit kommen Sensoren (Weenat, CropX) in verschiedenen Tiefen zum Einsatz. Die Besuchenden zeigten reges Interesse an den praktischen Erfahrungen zur Installation des Systems, zur Einsparung von Arbeitszeit und Wasser sowie zur Frage, wie sich die Bewässerungsart auf Ertrag, Wurzelverhalten und Unkrautdruck auswirkt.
Als letzten Versuch der Station stellte Lena Lips noch den Humuslangzeitversuch vor, der dieses Jahr gestartet ist. Dabei wird mithilfe von Kompost, dem Einsatz von Zwischenfrüchten sowie einer unterschiedlichen Bodenbearbeitung versucht, den Humusgehalt auf dieser Parzelle wieder anzuheben. Da dies nicht von Heute auf Morgen geschehen kann, soll dieser Versuch einige Jahre mit unterschiedlichen Gemüsekulturen stehen bleiben. Außerdem finden hier einige Bodenuntersuchungen statt, um verschiedene Bodenparameter wie z.B. die Infiltrationsgeschwindigkeit, den Bodenwiderstand und die mikrobielle Bodenaktivität genauer zu bestimmen.
Station 4: Öko-Versuche im Freiland Teil II
Die letzte Station startete mit einem Versuch zum intensiven Striegeleinsatz in der Säzwiebel, um Handarbeitsstunden bei der Beikrautregulierung im Zwiebelanbau zu reduzieren. Hierbei wird die Verträglichkeit des Striegelns in verschiedenen Wachstumsstadien untersucht, indem der Striegel in unterschiedlichen Intensitäten und Ausführungen zum Einsatz kommt. Beurteilt wird außerdem der Erfolg der Beikrautregulierung in den verschiedenen Striegelvarianten.
Als nächster Punkt präsentierte das Technologie- und Förderzentrum Straubing (TFZ) das Projekt OptiMulch, das durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt sowie das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gefördert wird. Gemeinsam mit der LWG wird ein aufspritzbares, biogenes Mulchmaterial weiterentwickelt und optimiert, das durch seine physikalische Barrierewirkung die Keimung und das Wachstum unerwünschter Unkräuter hemmt. Das Material härtet nach der Anwendung sofort auf der Feldoberfläche aus und baut sich im Verlauf der Vegetationsperiode biologisch ab. Im Jahr 2025 liegt der Fokus auf dem Einsatz des Mulchmaterials bei der Kultivierung der Einlegegurke.
Andrea Spirkaneder gab im Anschluss daran einen Einblick in den Versuch zum Thema minimale Bodenbearbeitung mit dem Geohobel. Um herauszufinden, inwiefern eine schonende und flache Minimalbearbeitung des Bodens im Gemüsebau funktionieren kann, wird der Einsatz des Geohobels mit einer intensiven Standardbearbeitung (Pflügen, Grubbern, Fräsen, etc.) verglichen. Erfasst werden nicht nur die Auswirkungen auf verschiedene Kulturen, sondern auch Effekte auf den Boden, die sich bereits nach zweijähriger Anwendung zeigten. Der Versuch wird in den nächsten Jahren fortgeführt, um langfristige Auswirkungen feststellen zu können.
Als letzten Part der Station stellte Marco Stadter den Landessortenversuch, der seit 2019 am Gemüsebauversuchsbetrieb Bamberg läuft, vor. Dabei werden elf frühe bis sehr frühe Kartoffelsorten zur Beurteilung von Resistenz, Anbaueigenschaft, Speisequalität und Ertrag unter typischen Anbaubedingungen des ökologischen Landbaus getestet.
Insgesamt war es ein sehr gelungener Tag für die Mitarbeitenden ebenso wie für die Teilnehmenden des Öko-Gemüsebautages. Wir freuen uns, Sie alle im nächsten Jahr am 7. Juli 2026 in Bamberg wiederzusehen.