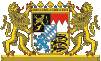Nachbericht Online-Winterberichtsreihe im Januar/Februar 2025
Aktuelles aus dem Arbeitsbereich Umweltgerechte Erzeugung

An fünf Mittwochabenden im Januar/Februar lud die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) zu ihrer bereits dritten Online-Winterberichtsreihe „Aktuelles aus dem Arbeitsbereich Umweltgerechte Erzeugung“ ein. Für jeweils 1,5 Stunden wurden den teilnehmenden Interessenten neue Forschungsinformationen im Bereich des Gemüsebaus aus dem Erwerbsgartenbau präsentiert. Die Forschungstätigkeiten erfolgten am Gemüsebauversuchsbetrieb in Bamberg und an weiteren Standorten in Bayern. Die Mitarbeitenden bedanken sich für die regen Teilnahmen und den interessanten Austausch mit der Praxis, mit dessen Input weitere Versuchstätigkeiten umgesetzt werden können.
Gemüsebauversuche des Kompetenzzentrums Ökogartenbau (29.01.2025)

Die Online-Winterberichtsreihe wurde in der ersten Veranstaltung mit der Vorstellung verschiedener Gemüsebauversuche des Kompetenzzentrums Ökogartenbau eröffnet. Zahlreiche Teilnehmende informierten sich über eine geeignete Winterbegrünung im Gewächshaus und die positive Wirkung verschiedener Zwischenfrüchte auf das Mikrobiom. Auf großes Interesse stieß auch die Vorstellung des Langzeitversuchs zur minimalen Bodenbearbeitung mit dem Geohobel. Andrea Spirkaneder präsentierte hierbei erste Erkenntnisse im Umgang mit dem Geohobel und stellte die Auswirkungen einer Minimalbearbeitung auf Kultur und Boden dar. Anschließend wurden mit den Teilnehmenden Erfahrungen zum Striegeleinsatz in Zwiebeln geteilt. In einem „Stresstest“ für die Zwiebel wurde untersucht, welche Techniken und Vorgehensweisen ein intensives Striegeln ermöglichen und so den Beikrautdruck effektiv reduzieren ohne die Zwiebeln dabei stark zu schädigen. Zum Abschluss wurden zwei Versuche zur natürlichen Nützlingsförderung bzw. Schädlingsreduktion vorgestellt: Beim additiven Intercropping wurden Arten wie Ringelblume und Kornblume in einen Kohlbestand integriert um Nützlinge anzulocken und deren Wirkung auf Schädlinge zu nutzen. Eine Zwischenpflanzung von Gerste in einen Porreebestand dagegen sollte zu einer Ablenkung von Thripsen führen.
Autonome Hackroboter im Gartenbau (05.02.2025)

Am 05.02.2025 informierten sich die Teilnehmenden im Rahmen der Online-Winterberichtsreihe über den Einsatz autonomer Hackroboter im Gartenbau. Leonie Seehafer stellte die Versuchsergebnisse des seit Februar 2025 abgeschlossenen Forschungsprojekts „Innovative Methoden zur ökologischen Beikrautregulierung im Gartenbau“ vor, innerhalb dessen unter anderem die Erprobung und Bewertung autonomer Hackroboter beleuchtet wurden. Hierzu waren die Roboter in verschiedenen Gemüsebaukulturen und in einer Obstbaumschule im Einsatz und wurden hinsichtlich ihrer Funktionalität und Wirtschaftlichkeit getestet. Erprobt wurden die Roboter „Farming GT“ (Farming Revolution), „Dino“ (Naio Technologies), „FD20“ (FarmDroid) und „Oz“ (Naio Technologies). Im Rahmen der Veranstaltung wurde zunächst eine Übersicht über den Stand der Technik gegeben. Es wurden unterschiedliche technische Systeme und Ausstattungen anhand der erprobten Roboter thematisiert. Neben den Vorteilen wurden auch die Grenzen des Hackrobotereinsatzes beleuchtet. Aktuelle Praxiserfahrungen mit den autonomen Hackrobotern und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung waren ebenfalls Thema der Veranstaltung.
Obstbauversuche und Düngebedarfsversuche bei Weihnachtsbäumen im Kompetenzzentrum Ökogartenbau (12.02.2025)

Am 12.02.2025 wurden in der Online-Winterberichtsreihe die verschiedenen Obstbauversuche sowie der Düngeversuch bei Weihnachtsbäumen thematisiert. Zunächst wurden den Teilnehmenden die Beerenobstversuche mit Erdbeeren und Heidelbeeren durch den zuständigen Versuchsbetreuer Ruben Pires Heise vorgestellt. Im Erdbeersortenversuch wurden zehn verschiedene Sorten hinsichtlich ihrer Ertragsleistung und Qualität verglichen. Ergänzend gab es Einblicke in einen Heidelbeeranbauversuch, der als Tastversuch durchgeführt wurde. Ein weiteres Thema war der Haselnussanbau. Hier wurde sowohl ein Schnittversuch vorgestellt, in dem untersucht wurde, wie sich verstärkte Schnittmaßnahmen auf den Ertrag in den Folgejahren auswirken, als auch ein Ernteversuch, in dem der Einsatz von Erntenetzen getestet wurde.
Abschließend wurden die Ergebnisse des Düngeversuches bei Weihnachtsbäumen von Nicolas Müller vorgestellt. Er stellte dabei die kürzlich abgeschlossenen mehrjährigen Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Düngungsstrategien bei Nordmanntannen vor. Zunächst wurden die Versuche am Standort Augsburg vorgestellt, bei denen unterschiedliche Düngungsvarianten verglichen wurden. Anschließend wurden die Untersuchungen am Standort im Spessart erläutert, wo verschiedene Düngungstermine und Düngerarten getestet wurden. Neben der Düngung wurde auch der Einfluss von Standortbedingungen und Unterwuchs auf das Wachstum der Bäume beleuchtet. Abschließend wurden verschiedene Punkte zu den aktuellen Herausforderungen im ökologischen Weihnachtsbaumanbau, zum Versuchsdesign sowie zu den Standortansprüchen der Nordmanntannen und deren Anforderungen an die Düngung diskutiert.
Abschließend wurden die Ergebnisse des Düngeversuches bei Weihnachtsbäumen von Nicolas Müller vorgestellt. Er stellte dabei die kürzlich abgeschlossenen mehrjährigen Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Düngungsstrategien bei Nordmanntannen vor. Zunächst wurden die Versuche am Standort Augsburg vorgestellt, bei denen unterschiedliche Düngungsvarianten verglichen wurden. Anschließend wurden die Untersuchungen am Standort im Spessart erläutert, wo verschiedene Düngungstermine und Düngerarten getestet wurden. Neben der Düngung wurde auch der Einfluss von Standortbedingungen und Unterwuchs auf das Wachstum der Bäume beleuchtet. Abschließend wurden verschiedene Punkte zu den aktuellen Herausforderungen im ökologischen Weihnachtsbaumanbau, zum Versuchsdesign sowie zu den Standortansprüchen der Nordmanntannen und deren Anforderungen an die Düngung diskutiert.
Ökologische Freiland- und Unter Glas-Versuche (19.02.2025)

Am 19. Februar 2025 nutzten rund 50 Teilnehmende die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Onlineveranstaltung über die Forschungsschwerpunkte der LWG Bamberg sowie die aktuellen Versuchsergebnisse der ökologischen Freiland- und Unterglas-Versuche des vergangenen Jahres zu informieren.
Zu Beginn präsentierte Lena Lips den Fenchelsortenversuch, der im vergangenen Jahr mit zusätzlichen Sorten erneut durchgeführt wurde. Die Knollen wurden in drei Sätzen angebaut, um die unterschiedlichen Auswirkungen der Jahreszeiten zu analysieren und die Sorten hinsichtlich Knollenform und Haltbarkeit zu bewerten. Anschließend stellte sie den Leguminosen-Stickstoff-Düngungsversuch vor. Dabei wurden selbst angebaute Leguminosen geschrotet und als Stickstoffdünger in einer Wirsingkultur mit handelsüblichen Düngern verglichen. Neben der Auswertung der Erträge der verschiedenen Düngungsvarianten und der Veränderungen der Nmin-Werte im Boden untersuchte sie auch die Wirtschaftlichkeit der selbst produzierten Dünger im Vergleich zu den zugekauften Düngern.
Im zweiten Veranstaltungsteil stellte Carola Nitsch ihre Versuchsergebnisse vor. Dabei ging es zum einen um den Untersaatenversuch im Gewächshaus, der 2023 bei Rispentomaten und 2024 bei Blockpaprika durchgeführt wurde. Dieser Versuch wurde im Zuge der Verpflichtung zur Gründüngung im Gewächshaus ins Leben gerufen. Verschiedene Untersaatenmischungen wurden hinsichtlich ihrer Eignung in der Fruchtgemüsekultur verglichen und ihre Auswirkungen auf die Kulturpflanzen bewertet. Darüber hinaus präsentierte sie einen Ernteverfrühungsversuch bei Spitzpaprika im Folientunnel. Ziel war es, den Erntetermin der Paprikapflanzen zu beschleunigen. Dazu wurden unterschiedliche Methoden eingesetzt, darunter die Verwendung von Mypexgewebe in Kombination mit Lochfolienabdeckung sowie Lochfolie mit variierender Nutzungsdauer.
Zu Beginn präsentierte Lena Lips den Fenchelsortenversuch, der im vergangenen Jahr mit zusätzlichen Sorten erneut durchgeführt wurde. Die Knollen wurden in drei Sätzen angebaut, um die unterschiedlichen Auswirkungen der Jahreszeiten zu analysieren und die Sorten hinsichtlich Knollenform und Haltbarkeit zu bewerten. Anschließend stellte sie den Leguminosen-Stickstoff-Düngungsversuch vor. Dabei wurden selbst angebaute Leguminosen geschrotet und als Stickstoffdünger in einer Wirsingkultur mit handelsüblichen Düngern verglichen. Neben der Auswertung der Erträge der verschiedenen Düngungsvarianten und der Veränderungen der Nmin-Werte im Boden untersuchte sie auch die Wirtschaftlichkeit der selbst produzierten Dünger im Vergleich zu den zugekauften Düngern.
Im zweiten Veranstaltungsteil stellte Carola Nitsch ihre Versuchsergebnisse vor. Dabei ging es zum einen um den Untersaatenversuch im Gewächshaus, der 2023 bei Rispentomaten und 2024 bei Blockpaprika durchgeführt wurde. Dieser Versuch wurde im Zuge der Verpflichtung zur Gründüngung im Gewächshaus ins Leben gerufen. Verschiedene Untersaatenmischungen wurden hinsichtlich ihrer Eignung in der Fruchtgemüsekultur verglichen und ihre Auswirkungen auf die Kulturpflanzen bewertet. Darüber hinaus präsentierte sie einen Ernteverfrühungsversuch bei Spitzpaprika im Folientunnel. Ziel war es, den Erntetermin der Paprikapflanzen zu beschleunigen. Dazu wurden unterschiedliche Methoden eingesetzt, darunter die Verwendung von Mypexgewebe in Kombination mit Lochfolienabdeckung sowie Lochfolie mit variierender Nutzungsdauer.
Erdeloser Anbau von Tomaten, Melonen, Salat und Ingwer (26.02.2025)

Circa 35 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit mit Martin Schulz auf die Versuchsarbeit 2024 im Bereich des erdelosen Anbaues zurückzublicken. Ein Versuch bzw. ein Kurzprojekt beschäftigten sich mit dem Thema Automatisierung und Digitalisierung im Gemüsebau.
Im ersten Versuch ginge es um den Einsatz von Phytosensoren im Tomatenanbau. Die Phytosensoren einschließlich der Auswertung der Messdaten werden von der Schweizer Firma Vivent angeboten. Mit Hilfe der Messung der Spannungsdifferenz können Aussagen zu Pflanzenstress gemacht werden. Dabei gibt es 2 Methoden. Zum einen werden rückwirkend Abweichungen vom Pflanzenrhythmus, zum anderen werden die Messwerte mit Referenzkurven verglichen, welche Aussagen zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines spezifischen Stresses geben. Ein Kurzprojekt beschäftigte sich mit dem Einsatz von Drohnen im Salatanbau. Projektziel war es, die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen für den Anbau von Salat zu prüfen. Das Angebot bestand aus einer autonom agierenden Indoor-Drohne, welche zur Bestandsüberwachung von Wachstum und Pflanzengesundheit eingesetzt werden kann. Nach Flugende wurden die Bilder in eine anbietereigene Cloud hochgeladen und ausgewertet. Der Flugbericht einschließlich der Bildabfolge wurde bis zum Ende ständig optimiert. Die Qualität und Auflösung der Bilder ließen ein Bestandsmonitoring im Hinblick auf Pflanzenwachstum und -zustand (Schädlinge. Krankheiten, sonstige Anomolien) zu. Am Ende der Projektlaufzeit konnte mit Hilfe von im Bestand implementierten QR-Codes die Position jedes einzelnen Salatkopfes genau bestimmt werden. Aussagen zu Pflanzenzustand und -gesundheit sind mit Hilfe der gemachten Fotos durch das menschliche Auge möglich. Erkannt wurden Anomalien von mehr als 1 mm. Eine automatische visuelle Erkennung ist nach einem Anlernen der Software in der Zukunft möglich. Der Einsatz von Drohnen ist in (naher) Zukunft nach einer technischen Optimierung der Drohne und der inhaltlichen Optimierung denkbar und dann betriebswirtschaftlich empfehlenswert.
Abschließend wurden die Ergebnisse von 2 Anbauversuchen vorgestellt. Im ersten Versuch wurden Wassermelonen, veredelt und unveredelt, auf ihre Eignung für den geschützten hydroponischen Anbau geprüft. Als Substrat wurde ein Holzfaser-Kokosgemisch verwendet. Die Ertragsergebnisse waren betriebswirtschaftlich in der Gesamtheit unbefriedigend. Es wurde nur ein durchschnittlicher Ertrag von 2,8 kg bei bis zu 2 geernteten Früchten/m² erreicht. Angestrebt ist jedoch eine Kostendeckung von circa 80 €/m² das wären circa > 15 Früchte/m². Eine Veredlung führt zu einer ein- bis vierwöchigen Verfrühung und sortenbedingt zu einer Ertragserhöhung durch ein größeres Fruchtgewicht. Fortgeführt wurde die Optimierung des hydroponischen Anbaus von Ingwer. Die geprüften Substrate Kokos, ein Holzfaser-Perlit-Gemisch und ein inertes Substrat aus regional gewonnenem Blähton eignen sich für einen hydroponischen Anbau. Die Erträge schwankten in Abhängigkeit von Sorte und Substrat zwischen 6,0 und 9,2 kg/m².
Im ersten Versuch ginge es um den Einsatz von Phytosensoren im Tomatenanbau. Die Phytosensoren einschließlich der Auswertung der Messdaten werden von der Schweizer Firma Vivent angeboten. Mit Hilfe der Messung der Spannungsdifferenz können Aussagen zu Pflanzenstress gemacht werden. Dabei gibt es 2 Methoden. Zum einen werden rückwirkend Abweichungen vom Pflanzenrhythmus, zum anderen werden die Messwerte mit Referenzkurven verglichen, welche Aussagen zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines spezifischen Stresses geben. Ein Kurzprojekt beschäftigte sich mit dem Einsatz von Drohnen im Salatanbau. Projektziel war es, die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen für den Anbau von Salat zu prüfen. Das Angebot bestand aus einer autonom agierenden Indoor-Drohne, welche zur Bestandsüberwachung von Wachstum und Pflanzengesundheit eingesetzt werden kann. Nach Flugende wurden die Bilder in eine anbietereigene Cloud hochgeladen und ausgewertet. Der Flugbericht einschließlich der Bildabfolge wurde bis zum Ende ständig optimiert. Die Qualität und Auflösung der Bilder ließen ein Bestandsmonitoring im Hinblick auf Pflanzenwachstum und -zustand (Schädlinge. Krankheiten, sonstige Anomolien) zu. Am Ende der Projektlaufzeit konnte mit Hilfe von im Bestand implementierten QR-Codes die Position jedes einzelnen Salatkopfes genau bestimmt werden. Aussagen zu Pflanzenzustand und -gesundheit sind mit Hilfe der gemachten Fotos durch das menschliche Auge möglich. Erkannt wurden Anomalien von mehr als 1 mm. Eine automatische visuelle Erkennung ist nach einem Anlernen der Software in der Zukunft möglich. Der Einsatz von Drohnen ist in (naher) Zukunft nach einer technischen Optimierung der Drohne und der inhaltlichen Optimierung denkbar und dann betriebswirtschaftlich empfehlenswert.
Abschließend wurden die Ergebnisse von 2 Anbauversuchen vorgestellt. Im ersten Versuch wurden Wassermelonen, veredelt und unveredelt, auf ihre Eignung für den geschützten hydroponischen Anbau geprüft. Als Substrat wurde ein Holzfaser-Kokosgemisch verwendet. Die Ertragsergebnisse waren betriebswirtschaftlich in der Gesamtheit unbefriedigend. Es wurde nur ein durchschnittlicher Ertrag von 2,8 kg bei bis zu 2 geernteten Früchten/m² erreicht. Angestrebt ist jedoch eine Kostendeckung von circa 80 €/m² das wären circa > 15 Früchte/m². Eine Veredlung führt zu einer ein- bis vierwöchigen Verfrühung und sortenbedingt zu einer Ertragserhöhung durch ein größeres Fruchtgewicht. Fortgeführt wurde die Optimierung des hydroponischen Anbaus von Ingwer. Die geprüften Substrate Kokos, ein Holzfaser-Perlit-Gemisch und ein inertes Substrat aus regional gewonnenem Blähton eignen sich für einen hydroponischen Anbau. Die Erträge schwankten in Abhängigkeit von Sorte und Substrat zwischen 6,0 und 9,2 kg/m².