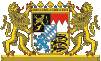Rückblick - Veranstaltung
Sommer-Fachtagung Zierpflanzenbau 2025

Unter dem Motto „Starke Vielfalt“ lud die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim zur traditionellen Sommer-Fachtagung Zierpflanzenbau ein. Rund 250 Gäste sowie Vertreter von 44 ausstellenden Firmen folgten der Einladung, um sich über aktuelle Entwicklungen im Zierpflanzenbau zu informieren.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Referenten und Moderatoren
Roland Öller sagte: „An der LWG wird die Vielfalt eines breiten Sortiments im Zierpflanzenbau präsentiert. Von einjährigen Sommerblumen über mehrjährige Stauden bis hin zu Kleingehölzen und Genusspflanzen werden neue Sorten gesichtet – ein unverzichtbarer Service für unsere Gärtner. So kann die Branche moderne, züchterisch optimierte Sortimente produzieren.“ Besonders für den zahlreich vertretenen Nachwuchs sei dies von großer Bedeutung – ein Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Gartenbau.
Im Zentrum der diesjährigen Vorträge standen die Top-Sorten des Sommerflors an der LWG sowie aktuelle kultur- und pflanzenschutztechnische Herausforderungen in der Anzucht.
Kulturhinweise Sommerflor 2025
Bevor die rund 820 Testsorten namhafter Züchter auf den Versuchsfeldern der LWG ihre volle Blütenpracht entfalten, ist eine sorgfältige und erfolgreiche Anzucht entscheidend. Mit einem detaillierten Einblick in diese Phase eröffnete Gärtnermeister Thomas Schneider die Vortragsreihe der diesjährigen Sommer-Fachtagung.
Die Sorten wurden in Kalenderwoche 11 in torfreduziertes Substrat von Einheitserdewerk Patzer Blue Topf + Perlite mit 35 % Weißtorfanteil getopft – vorwiegend in Töpfe der Größe T12. Die Düngung erfolgte über das Gießwasser mit 0,08 bis 0,1%ige Ferty EcoPhos 3 Mega von Planta (NPK 18-6-18). Stutzen und Hemmstoffeinsatz wurden nach Bedarf durchgeführt, als Hemmstoff kam einmalig Mitte April Shorttrack (0,3 %) zum Einsatz.
„In Veitshöchheim setzen wir auf einen harten Cool Morning“, erklärte Thomas Schneider. Die Heiztemperatur wird ab einer Stunde vor bis drei Stunden nach Sonnenaufgang auf 6 °C abgesenkt. Diese Strategie reduziert den Einsatz von Hemmstoffen und erspart Energie. Durch die kulturspezifische Temperaturanpassung auf 12 °C für kälteverträglichere und 16 °C für wärmeliebende Sorten konnten die Energiekosten um weitere 20 % reduziert werden.
Ein zentrales Anliegen Schneiders war der integrierte Pflanzenschutz mit Nützlingen. Der bislang regelmäßig notwendige Einsatz von Steinernema feltiae gegen Trauermückenlarven konnte 2025 entfallen – dank strikter Hygienemaßnahmen bei der Reinigung von Kultureinrichtungen, sorgfältiger Kontrolle der Jungpflanzen und gezielter Anstaubewässerung zur Vorbeugung.
Gegen Blattläuse wurden in den Kalenderwochen 13, 15 und 17 vorbeugend Schlupfwespenmischungen ausgebracht. Leider konnte kein parasitierter Befall festgestellt werden. Thomas Schneider vermutet, dass das Verfahren Cool Morning die wärmeliebenden Nützlinge negativ beeinflusste. Deshalb wurde zur Bekämpfung einmalig Teppeki eingesetzt.
Die Bekämpfung von Thripsen und Weichhautmilben gelang 2025 sehr gut. Engmaschige und genaue Kontrolle aller Jungpflanzen sowie rechtzeitiger und großzügiger Einsatz von Raubmilben der Arten Amblyseius cucumeris und Amblyseius barkeri in den Kalenderwochen 13, 15, 16 und 17 mit 100 bis 300 Tiere/m2 erwiesen sich als richtige Strategie.
Echter Mehltau war zum Teil ebenfalls schon an den Jungpflanzen vorhanden. Befallene Kulturen, wie z. B. Calibrachoa, Helianthus, Dahlia und Bidens wurden bis zur Verkaufsreife zweimal mit Score behandelt.
Aus den Erfahrungen dieses Jahres zieht Schneider klare Konsequenzen für die kommende Saison:
- Verzicht auf Steinernema – die bisherigen Hygienemaßnahmen zeigten ausreichend Wirkung.
- Statt Schlupfwespen werden Chrysoperla (Florfliegen) als Streuware in den Kalenderwochen 13 und 16 eingesetzt – sie sind unempfindlich gegenüber „Cool Morning“.
- Die Strategie der Raubmilben-Überschwemmung gegen Thripse und Weichhautmilben wird beibehalten.
Ab Kalenderwoche 19 wurden die vorgezogenen Sorten mit jeweils drei Pflanzen in 24-Liter-Container getopft. Erstmalig kam dabei für alle Kulturen das vollständig torffreie Substrat „Patzer Red Topf“ zum Einsatz. Die Bewässerung und Düngung erfolgt über Mikroschläuche mit Pfeiltropfern, gesteuert durch Sensoren der Firma Plantcare. Aufgrund des hohen Wasserhärtegrads wird dabei 0,1 bis 0,12 % Peters Excel Hard Water Grow (NPK 18-10-18) von ICL verwendet.
Wie sich das torffreie Substrat auf Qualität und Blütenfülle des Sommerflors auswirkt, lässt sich erst nach den letzten Bonituren Ende September abschließend beurteilen.
Top-Sorten des Veitshöchheimer Sommerflors
Ein zentrales Element der diesjährigen Sommerflor-Sichtung an der LWG Veitshöchheim war die Präsentation der bestbewerteten Sorten in der Kultur bis zur Vermarktungsreife Ende April bis Anfang Mai. Bei der Bewertung des umfangreichen Sortiments standen Kompaktheit bei möglichst geringem Hemmstoffeinsatz, erfolgreiche Anzucht mit hartem Cool Morning, Homogenität in der Entwicklung und Zeitpunkt der Vermarktungsreife im Fokus. Diese wichtige Einschätzung soll für Produktionsbetriebe und Endverkaufsgärtnereien als Entscheidungshilfe dienen, welche Sorten und Neuheiten am besten in die eigene Kulturführung und Vertriebs- und Verkaufssituation passen.
Versuchsingenieurin Christine Hartmann stellte die Sorten vor, die in der Anzucht besonders positiv aufgefallen sind. Dafür waren mindestens 8 von 9 Punkten in der Gesamtauswertung nötig.
- Calibrachoa 'Aloha Kona Red' von Dümmen Orange überzeugt durch ihre frühe Blüte und kompakte Wuchsform. Bereits sechs Wochen nach der Kultur waren 75 % der Pflanzen in Blüte – ganz ohne Stutzen oder Hemmstoffe.
- Auch bei den Petunien gab es herausragende Ergebnisse: Die Sorten 'Flower Shower Pinkermink' (Westhoff), 'Potunia Baby Pink' und 'Surprise Kardinal 2025' (beide Dümmen Orange). Alle drei Sorten zeigten bereits nach fünf Wochen Kulturzeit eine reiche Blüte. Sie wuchsen kompakt und homogen ohne regulatorische Eingriffe.
Starke Blütenleistung und besondere Blattschmuckpflanzen
- Gaillardia 'Gusto Orange Zest' (Danziger) zeigte sich ebenfalls als Highlight: Nach nur zehn Wochen Kulturzeit entwickelte sie ab Kalenderwoche 21 ohne Stutzen oder Hemmstoffe eine dichte, kompakte Wuchsform und leuchtend orange Blüten – ideal für den Einsatz im Sommertopf.
- Mandevilla 'Rose' (Gruppo Padana) wurde ebenfalls besonders positiv bewertet. Sie wächst ohne Ranken, ist hitzeverträglich und blühte ab Kalenderwoche 20.
- Bei den Plectranthus scutellarioides-Sorten stach 'Tropical Feather' (Kientzler) hervor und erreichte die Höchstnote für attraktiven Blattschmuck.
Unter den Pelargonien hob Christine Hartmann zwei robuste Vertreter hervor: Interzonal 'Mira' (Selecta One) und Interspecific Amazonia 'Vigorous Magic Pink' (Lazzeri). Beide Sorten kamen ebenfalls ohne Stutzen und Hemmstoffe aus.
Bei den Salvia der Salgoon-Serie (Hilverda Florist) fiel 'Lake Flamingo' durch kräftigen Wuchs und üppige Blüte auf. Die Sorten eignen sich hervorragend für große Töpfe (z. B. T17) und blühten nach einmaligem Stutzen und Stauchen bereits nach zehn Wochen. Zinnia Profusion Double Type 'White Improved' (Sakata) überzeugte als kompakte und blühfreudige Sorte.
Für schattige Standorte wurden ebenfalls geeignete Sorten erprobt. Besonders gut bewertet wurden folgende Begonien-Sorten:
- Beaugonia 'Red' (Begonien Rieger)
- Bellissa 'Yellow' (Kientzler)
- Begonia elatior Dreams Garden 'MacaRazz' (Beekenkamp)
Alle Ergebnisse der Anzucht-Bonituren sind im Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für den Gartenbau (LVG)-Sortenfinder der LVG Heidelberg nachzuschlagen. Neben der LWG Veitshöchheim beteiligen sich unter der Federführung der LVG Heidelberg auch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) Thüringen, die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen und das Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) Sachsen. In dieser Datenbank sind alle produzierten und bonitierten Sorten verschiedener Versuchsanstalten gelistet – eine wertvolle Hilfe für Gärtnerinnen und Gärtner sowie den öffentlichen Grünbereich.
Die vorgestellten Sorten seien laut Christine Hartmann nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Blütenpracht, die das Publikum nach den Vorträgen auf dem Versuchsgelände erwarte. Sie lud die Gäste herzlich zur Besichtigung der Versuchsflächen und zu Fachführungen mit detaillierten Erläuterungen ein.
Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau – Präzise Maßnahmen gegen komplexe Herausforderungen
In das Schwerpunktthema Pflanzenschutz stieg Isabella Lampe vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz mit einer Einführung in das digitale Dokumentationstool „PS Info MeinBetrieb“ ein. Das Online-Tool, buchbar über das Hortigate-Portal, ermöglicht eine rechtskonforme und aktuelle Erfassung von Pflanzenschutzanwendungen. Durch die direkte Verknüpfung mit der PS-Info-Datenbank sind zugelassene Mittel stets auf dem neuesten Stand. Geeignete Präparate lassen sich unkompliziert dem digitalen „Spritzschrank“ hinzufügen. „PS Info MeinBetrieb“ unterstützt Betriebe somit gezielt bei der Prozessoptimierung und beim Abbau bürokratischer Hürden. Weitere Informationen konnten Besucher direkt am Fachstand von Frau Lampe erhalten.
Rainer Wilke, langjähriger Pflanzenschutzberater im Zierpflanzenbau bei der Landwirtschaftskammer (LWK) Nordrhein-Westfalen, griff in seinem Vortrag die zunehmenden Herausforderungen im Pflanzenschutz auf. Klimabedingte Veränderungen, neue und resistente Schadorganismen sowie eine stetig schrumpfende Anzahl wirksamer zugelassener Mittel machen effektive Bekämpfungsstrategien immer schwieriger. Ein zentrales Problem: Der Zierpflanzenbau stellt einen kleinen Marktsektor dar – Neuzulassungen lohnen sich für Hersteller oft nicht. Hinzu kommen politische Vorgaben und die Anforderungen des Einzelhandels, die den Einsatz wirksamer Wirkstoffe weiter einschränken. Dabei sind parasitäre Schaderreger für bis zu 50 % aller Schäden in den Kulturen verantwortlich.
Aktuelle Problemfelder im Überblick
Rainer Wilke ging auf zwei praxisrelevante Virusgruppen ein:
- Die Tospoviren (z. B. Tomatenbronzefleckenvirus, Impatiens-Nekrosefleckenvirus) haben ein breites Wirtsspektrum, darunter zahlreiche Zierpflanzen, Gemüse und Beikräuter. Sie werden vor allem durch verschiedene Thripse, unter anderem der Gattung Frankliniella übertragen. Als Symptome treten chlorotische und nekrotische Blattflecken, Adernverfärbung sowie Deformationen auf. Da die wärmeliebenden Thripse durch den Klimawandel begünstigt werden, steigt das Infektionsrisiko. Auch Unkräuter wie Franzosenkraut oder Löwenzahn können als Virusreservoir dienen.
- Die Tobamoviren (z. B. Tabakmosaikvirus) werden vorwiegend mechanisch durch Kulturarbeiten übertragen. Besonders betroffen sind Solanaceae wie Petunia und Calibrachoa. Schutzmaßnahmen vor Viren sind strikte Hygiene, Bekämpfung der Vektoren, Isolation befallener Pflanzen sowie Einsendung verdächtiger Proben an die amtlichen Pflanzenschutzdienste.
Ein wachsendes Problem stellen auch bakterielle Erkrankungen dar, insbesondere die Gattung Xanthomonas könnte von den seit Jahren steigenden Temperaturen noch mehr profitieren (z. B. Xanthomonas hortorum pv. pelargonii). Diese Bakterien sind meist wirtsspezifisch, wie z. B. Xanthomonas hortorum pv. pelargonii an Pelargonien. Sie breiten sich unter warmen, feuchten Bedingungen rasch aus. Xanthomonas ist durch eine Schleimhülle besser gegen Austrocknung geschützt als andere Bakterien. Das Bakterium infiziert über die Spaltöffnungen der Blätter und breitet sich zunächst im Laub aus.
Symptome bei Pelargonien sind z. B. auffällige dunkle Blattflecken („Rehaugen“) und Welkeerscheinungen, oft schwer von physiologischer Welke zu unterscheiden. Serologische Schnelltests können frühzeitig Hinweise liefern, bevor Wurzelbefall einsetzt und sich der Erreger über die Stellfläche auf andere Pflanzen ausbreitet. Maßnahmen: schnelle Isolation befallener Pflanzen, Labordiagnose und vorbeugende Anwendungen bei Blattflecken bildenden Bakterien mit Kupferpräparaten sofern die Verträglichkeit geklärt ist. Direkte Heilmittel stehen nicht zur Verfügung.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Pilzkrankheiten (© Rainer Wilke, LKW NRW)
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Schädlinge (© Rainer Wilke, LKW NRW)
Die Akarizide Kiron und Milbeknock sind nach aktuellen Versuchen des Pflanzenschutzdienstes (PSD) NRW gut wirksam, jedoch schädlich für Nützlinge. Floramite 240 SC und Kanemite SC sind nützlingsschonender, aber mit etwas geringerer Wirksamkeit. Sorgfältige Kontrolle von Jungpflanzenimporten und ein gutes Feuchtigkeitsmanagement im Gewächshaus beugen dem Befall vor.
Rainer Wilkes Vortrag machte deutlich, dass der Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau zunehmend von strategischer Präzision, Wissen über Pathogene und einem integrierten, vorbeugenden Ansatz geprägt sein muss. Die Kombination aus digitaler Dokumentation, frühzeitiger Diagnostik, konsequenter Hygiene und gezieltem Einsatz verfügbarer Mittel bietet die besten Chancen, dem zunehmenden Druck durch Krankheiten und Schädlinge zu begegnen.
Fachausstellung und „Starke Vielfalt“ auf den Versuchsfeldern
Im Anschluss an das Vortragsprogramm bot die große Fachausstellung den Besucherinnen und Besuchern sowie den ausstellenden Firmen die Gelegenheit zum intensiven Austausch über innovative Produkte und Sortimente aus allen Bereichen der grünen Branche.
Neben zahlreichen Züchterfirmen und Vertretern aus dem Bereich Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Naschgemüse und Obstsorten präsentierten sich auch Unternehmen aus den Bereichen moderne Gewächshaustechnik, Substrate, Düngemittel und Pflanzenstärkungsmittel.
Ein weiteres Highlight war der Rundgang über die blühenden Versuchsfelder der LWG, auf denen die enorme Sortenvielfalt eindrucksvoll zur Geltung kam. In geführten Rundgängen informierten die Versuchsingenieurinnen Christine Hartmann, Beatrix Bieker-Royackers und Claudia Taeger die Besucherinnen und Besucher über die Top-Sorten für ein zukunftsfähiges Sortiment – fachlich fundiert und praxisnah erläutert. Die zusätzlichen Schwerpunkte der Gartenleistungssichtung 2025, wie die Eignung als Schnittblume im Hausgarten, der Einsatz im öffentlichen Grün und die Witterungsbeständigkeit von Petunien konnten am besten direkt vor Ort erläutert werden.
Der Termin für die Sommer-Fachtagung im kommenden Jahr steht bereits fest: Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, lädt die LWG wieder nach Veitshöchheim ein – ein Datum, das sich alle Interessierten schon jetzt im Kalender vormerken sollten.