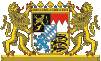Forschungs- und Innovationsprojekt
Entwicklung einer automatisierten Entscheidungshilfe zur ressourcenschonenden Bewässerung in Gartenbau und Landwirtschaft

Entwicklung einer automatisierten Entscheidungshilfe zur ressourcenschonenden und effizienten Bewässerung in Gartenbau und Landwirtschaft mit dem Ziel, Wasserverteilung und Stickstoffausnutzung zu optimieren
Durch die Sommertrockenheit ist das Thema Wasser und Agrarproduktion in allen Bereichen präsent, in der Gesellschaft, der Politik, der Wasserwirtschaft und natürlich in den landwirtschaftlich gärtnerischen Betrieben. Die geringen Niederschläge mussten vielfach durch zusätzliche Bewässerungsgaben ausgeglichen werden. Die Entnahmekapazitäten wurden erreicht bzw. überschritten. Ferner bereitet auch der Nitratgehalt der Trinkwasserquellen Anlass zum Handeln. Die Gesellschaft wünscht Produkte aus der Region, die ressourcenschonend produziert werden. Es ist zu erwarten, dass Politik und auch der Handel mit verstärkten Auflagen und dem Nachweis der Wasserverwendung reagieren. Der Anbauer steht unter Druck, die Effizienz der Bewässerung weiter zu verbessern.
Hintergrund und Ziele
Damit die Bewässerung effizienter, aber trotzdem anwenderfreundlich erfolgen kann, müssen objektive Entscheidungshilfen wie Bodenfeuchtesensoren oder Modellrechnungen in das Bewässerungsmanagement einfließen. Es ist notwendig, den Produktionsbetrieben praxistaugliche und flexible Lösungsansätze anzubieten, um unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten auf die Folgen des Klimawandels, den gestiegenen Anforderungen des Marktes und den veränderten rechtlichen Vorgaben reagieren zu können.
Methode des Projektes
Das Projekt baute auf vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse und bereits entwickelte Produkte auf. Aufgrund neuer Technologien im Bereich der funkbasierten Automatisierung besteht die Möglichkeit auch Flächen ohne eigene Stromversorgung zu automatisieren. Die OpenData Initiative bietet innovative Ansätze im Bereich der Bewässerungssteuerung. Bodendaten und Witterungsdaten können so den Betrieben ohne eigene Erhebung zur Verfügung gestellt werden, was den Aufwand und die Bedienung von modellbasierten Steuerungsverfahren wesentlich vereinfachen kann. Zur Verbesserung der Wasserverteilung, der Ermittlung von praxisnahen Basisdaten zum Einsatz von Tropfbewässerungssystemen und der Automatisierung wurden verfahrenstechnische Vergleiche in den Praxisbetrieben und bei den Projektpartnern durchgeführt. Zur Evaluierung der Systeme wurden neben den klassischen Methoden der Versuchsauswertung moderne Techniken wie digitale Bodensensoren und Drohnenflüge eingesetzt.
Ergebnisse des Projektes
Die Praxistauglichkeit einiger Systeme wurde erfolgreich nachgewiesen, auch wenn kleinere Nachbesserungen notwendig waren. Die Sensorhersteller liefern größtenteils funktionsfähige Systeme, wobei die Handhabung teils jedoch sehr unterschiedlich ist. Unsere Erfahrung mit digitalen Systemen zur Messung der Bodenfeuchte zeigten, dass für einen erfolgreichen Einsatz mit entsprechender Akzeptanz bei den Betrieben eine unabhängige Beratung nötig ist. Dies betrifft z. B. den Einbau, Platzierung und Anzahl der Sensoren, Interpretation der Messwerte, sowie die Festlegung der Ein- und Ausschaltpunkte nach Kalibrierung auf den jeweiligen Boden. Die Erkenntnisse dieses Projekts können hierbei für die Beratung als Grundlage dienen.
Bereits einfache und kostengünstige Maßnahmen können für eine gleichmäßige Wasserverteilung bei Rohrberegnung sorgen, welche Voraussetzung ist für einen einheitlichen Aufwuchs der Kulturen. Wird das Wasser homogen auf der Fläche verteilt, sind die Bewässerungszeiten und somit auch die Verdunstungsverluste geringer. Der Wasserverbrauch wird verringert und Kosten gesenkt. Eine gleichmäßige Wasserverteilung erleichtert auch die Standortauswahl für Bodenfeuchtesensoren zur Entscheidung über Bewässerungsgaben (Zeitpunkt, Höhe). Zu empfehlen für eine gleichmäßige Wasserverteilung sind: die Aufbauverbände 12 m x 12 m und 12 m x 18 m, die Wurfweite sollte mindestens so hoch sein wie Kreisregner-Abstände, die Verwendung von gleichen Regnern mit gleicher Düse im Aufstellverband, Sorgfalt bei Aufbau des Verbandes und den anliegenden Wasserdruck an den Kreisregnern mit einem Manometer zu bestimmen (der Druck bestimmt wesentlich die Wurfweite).
Zur genaueren Beurteilung der eingesetzten Sensortechnik und Modellrechnung mittels der Bewässerungs-App der ALB wurden mehrere Exaktversuche im Sinne einer Defizitbewässerung angelegt. Diese Teilergebnisse stellen einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Beratung hinsichtlich digitaler Entscheidungshilfen im Bewässerungsmanagement dar. Es zeigte sich, dass bei den Kulturen Kopfsalat, Kohlrabi, Weißkraut und Endivien eine um 20/30 % reduzierte Bewässerungsgabe im Vergleich zu den Empfehlungen der ALB-App negative bis z. T. stark negative Auswirkungen auf Erträge und Qualitäten hat. Die Bewässerung nach der ALB-App hatte deutlich höhere marktfähige Erträge (plus von 35 – 67 %) im Vergleich zu den Varianten mit reduzierter Bewässerung. Bei einem weiteren Exaktversuch erfolgte die Bewässerung nach Bodensaugspannung, indem die Einschaltpunkte der Bewässerung bei zwei Bewässerungsschwellen (300 und 600 hPa) lagen. Bei Rote Beete konnte beim Ertrag keine signifikanten Unterschiede zwischen den Varianten festgestellt werden. Bei Romanesco zeigte die Variante mit Einschaltpunkt der Bewässerung bei 300 hPa (niedrigere Bodensaugspannung) eine Ernteverfrühung um fünf Tage, verbesserte Qualität und eine höhere Abernte. Folglich lässt sich der Wasserverbrauch durch Nutzung von Bodenfeuchtesensoren senken. Die Höhe der Wassereinsparung ohne (größere) negative Auswirkungen auf Ertrag und Qualität ist aber von der Kultur und der Bodenart abhängig. Beides, digitale Bodenfeuchtesensoren und die ALB-App sind wichtige Entscheidungshilfen für ein effizientes und wassersparendes bewässern.
Im Bereich der funkbasierten Mess- und Steuertechnik konnte bereits während der Projektlaufzeit eine kontinuierliche Weiterentwicklung festgestellt werden. Mit den eingesetzten Technologien (GSM/LTE, NB-IoT, LoRa, Sigfox) erfolgt mittels Sensoren ein Monitoring der Bodenfeuchte. Je nach System können Schaltvorgänge bei Elektromagnetventilen (Wasser an/aus) per Smartphone/PC ausgelöst werden. Um eine Akzeptanz in der Praxis zu erreichen, müssen zukünftige Mess- und Steuersysteme ohne großen Installationsaufwand in Betrieb genommen werden können (Plug and Play). Die wesentlichen Vorteile der Automatisierung mittels Steuerungstechnik sind: jederzeit abrufbare Daten, z. T. in Echtzeit über Smartphone/PC, kontinuierliche und arbeitszeitsparende Dokumentation von z. B. Wasserverbrauch durch digitale Wasserzähler, Möglichkeit zur Erstellung von Bewässerungsplänen (z. B. Bewässerung in der Nacht), Benachrichtigungen z. B. bei ungewöhnlichen Ereignissen wie Leckagen per E-Mail/SMS/WhatsApp/App-Push-Benachrichtigungen.
Bei der Tropfbewässerung kann nach bisherigen Erkenntnissen die Performance der eingesetzten Tropfschläuche insoweit beurteilt werden, dass das preisgünstigste Material, ein dünnwandiger und drucksensitiver Tropfschlauch, lohnend ist. Druckkompensierende Tropfschläuche heben sich in ihrem Leistungsumfang in schwieriger Schlagtopografie nicht wesentlich von drucksensitiven Varianten ab und verursachen zusätzlichen Arbeitsaufwand sowie erhebliche Mehrkosten. Zeitpunkt und Höhe von Bewässerungsgaben sind an die kulturspezifischen Wasserbedarfe in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen anzupassen.
Die Bewässerungs-App der ALB Bayern e.V. wurde weiterentwickelt und die Anwenderfreundlichkeit erhöht. Beispielsweise wurden die Funktionen mobile Dokumentation von Wasserentnahmen, Bewässerungsmaßnahmen, automatisierte Berechnung von Entwicklungsstadien-Terminen und Anpassung der Durchwurzelungstiefen integriert.
Zur weiteren Erhöhung der Bewässerungseffizienz wird die Kombination von automatisierter Bewässerungssteuerung (Wasser an/aus) mit Verwendung der ALB Bewässerungs-App als digitale Entscheidungsgrundlage zu Start, Dauer und Ende der Bewässerungsgaben empfohlen. Zusätzlich sollte als Kontrolle und weitere Entscheidungshilfe die Nutzung einer eigenen Wetterstation sowie der Einbau von digitalen Bodenfeuchtesensoren in mindestens 2 Tiefen (15 und 30 cm) erfolgen. Da Bodensaugspannungssensoren leichter in die Praxis integrierbar sind, empfiehlt es sich diese zu verwenden. Diese sind weitestgehend unabhängig von der Bodenart, weshalb eine entsprechende Bodenkalibrierung entfällt. Dieser Ansatz bietet das größte Potential den Wasserverbrauch, bei einer an Ertrags- und Qualitätsanforderungen orientierter bedarfsgerechter Bewässerung, zu senken.
Zur erweiterten Projektseite
Projektinformationen
Projektleitung: Stefan Kirchner (LWG-IEF1)
Projektbearbeiter: Dr. Alexander Dümig (LWG-IEF1)
Laufzeit: 01.02.2020 bis 31.12.2023
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Projektpartner: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e.V. (ALB), Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Gemüsebaubetriebe, Wasserverbände
Förderkennzeichen: A/19/21