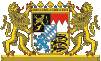Auswirkungen der Begrünung auf die Wanzenfauna
Auswirkungen der Begrünung auf die Wanzenfauna ausgewählter Weinberge Unterfrankens
Am Beispiel der Wanzen (Heteroptera) wurde untersucht, ob die Artengemeinschaft im allgemeinen und gefährdete und weinbaulichrelevante Arten im besonderen durch eine ökologisch ausgerichtete weinbauliche Bewirtschaftungsweise oder durch naturnahe Landschaftselemente im Rebgelände im Sinne der Biotopvernetzung profitieren. Ein wesentlicher Teil dieser Untersuchungen befasste sich mit dem Einfluss der Bodenvegetation auf die Artenstruktur und die Individuenzahl der Wanzenfauna in den Rebflächen.
Diese Arbeiten wurden im Rahmen einer Diplomarbeit an der Julius Maximilian Universität Würzburg durchgeführt
Ziel der Arbeit
Erkenntnisgewinn zum Einfluss der Bewirtschaftung bzw. der Gestaltung des weinbaulichen Umfeldes auf die Taxozönose Heteroptera (Wanzen). Wie hoch ist der Anteil räuberischer Wanzen, die Einfluss auf die Schädlingspopulation der Reben haben können.
Methodik
In einer Weinbaugemarkung im Maintal wurden in zwei verschiedenen Lagen jeweils eine ökologisch bewirtschaftete Rebfläche (BÖW) mit einer benachbarten, nach den
Vorgaben des Integrierten Weinbaus bewirtschafteten Rebfläche verglichen. Der Untersuchungszeitraum umfasste die Zeit von Mai bis September 1992.
Die Aufnahmen der Vegetation erfolgten im wöchentlich Rhythmus, wobei jeweils auf 100 m2 das Vorkommen der krautigen Pflanzen (ohne Gräser), unabhängig von der Häufigkeit der einzelnen Arten, erhoben wurden. Insgesamt konnten in den konventionell bewirtschafteten Rebflächen 31 und in
den ökologisch bewirtschafteten Rebflächen 88 verschiedene Pflanzenarten erfasst werden.
An 20 wöchentlichen Fangterminen wurden mittels Klopftrichter (Laubwand der Reben) und Streifnetz (Begrünung bzw. Boden) insgesamt 2.501 Wanzenindividuen
eingesammelt, die 89 Arten und 13 Familien zugeordnet wurden.
Vorgaben des Integrierten Weinbaus bewirtschafteten Rebfläche verglichen. Der Untersuchungszeitraum umfasste die Zeit von Mai bis September 1992.
Die Aufnahmen der Vegetation erfolgten im wöchentlich Rhythmus, wobei jeweils auf 100 m2 das Vorkommen der krautigen Pflanzen (ohne Gräser), unabhängig von der Häufigkeit der einzelnen Arten, erhoben wurden. Insgesamt konnten in den konventionell bewirtschafteten Rebflächen 31 und in
den ökologisch bewirtschafteten Rebflächen 88 verschiedene Pflanzenarten erfasst werden.
An 20 wöchentlichen Fangterminen wurden mittels Klopftrichter (Laubwand der Reben) und Streifnetz (Begrünung bzw. Boden) insgesamt 2.501 Wanzenindividuen
eingesammelt, die 89 Arten und 13 Familien zugeordnet wurden.
Ergebnisse
Vergleich ökologischer, integrierter und konventioneller Bewirtschaftung
In den ökologisch bewirtschafteten Rebflächen wurden insgesamt mehr als dreimal so viele Wanzen angetroffen wie in den integriert bewirtschafteten (1940 gegen 561).
Laubwand:
Mit 48 Arten in der ökologischen gegen 45 Arten in den integrierten Bewirtschaftungsweise, unterscheiden sich die Laubwände der beiden Varianten hinsichtlich Artenreichtum und Vielfalt nur geringfügig. Mehr als die Hälfte aller Larven in der Laubwand gehörten räuberischen Arten aus den Familien der Anthocorideae (Blumenwanzen) und Nabidae (Sichelwanzen) an. In der ökologischen Variante wurden signifikant weniger adulte (erwachsen) und juvenile (jugendliche) Individuen als in den konventionellen Varianten und weniger Vertreter von laut IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) nützlichen Arten gefangen.
Begrünung:
Im Unterwuchs der ökologisch bewirtschafteten Flächen waren mit 47 Arten nahezu dreimal so viele Arten vertreten wie in den konventionellen Rebflächen mit 16 Arten.
Es gab hier einen weitaus größerer Anteil von Arten, die nicht in der jeweils anders bewirtschafteten Fläche anzutreffen waren (68 % gegen 16 %). In den ökologisch bewirtschafteten Flächen traten vierzehn mal mehr adulte und sechs mal so viele juvenile Tiere auf.
Laubwand:
Mit 48 Arten in der ökologischen gegen 45 Arten in den integrierten Bewirtschaftungsweise, unterscheiden sich die Laubwände der beiden Varianten hinsichtlich Artenreichtum und Vielfalt nur geringfügig. Mehr als die Hälfte aller Larven in der Laubwand gehörten räuberischen Arten aus den Familien der Anthocorideae (Blumenwanzen) und Nabidae (Sichelwanzen) an. In der ökologischen Variante wurden signifikant weniger adulte (erwachsen) und juvenile (jugendliche) Individuen als in den konventionellen Varianten und weniger Vertreter von laut IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) nützlichen Arten gefangen.
Begrünung:
Im Unterwuchs der ökologisch bewirtschafteten Flächen waren mit 47 Arten nahezu dreimal so viele Arten vertreten wie in den konventionellen Rebflächen mit 16 Arten.
Es gab hier einen weitaus größerer Anteil von Arten, die nicht in der jeweils anders bewirtschafteten Fläche anzutreffen waren (68 % gegen 16 %). In den ökologisch bewirtschafteten Flächen traten vierzehn mal mehr adulte und sechs mal so viele juvenile Tiere auf.
Einfluss von Pflanzenschutzmittelstrategien
Es ist kein Einfluss der unterschiedlichen Pflanzenschutzmittelstrategien auf die Wanzenfauna zu erkennen, denn gerade im konventionell bewirtschafteten Reblaub wurden signifikant mehr adulte als auch juvenile Wanzen gefangen. Eventuell für die erhöhte Attraktivität der Bodenbegrünung in den ökologischen Varianten zu einem
Abwandern der Wanzen aus dem Reblaub in den Unterwuchs.
Abwandern der Wanzen aus dem Reblaub in den Unterwuchs.
Rote- Liste- und IOBC-Arten
In den beiden ökologisch bewirtschafteten Rebflächen waren fünf, in den konventionell bewirtschafteten drei Rote-Liste-Arten anzutreffen.
Als nützliche Wanzenarten im Sinne IOBC, traten vor allem Orius minutus, Nabis pseudoferus und Nabis ferus auf. Mit neun IOBC-Arten in den ökologischen und vier
IOBC-Arten in den konventionellen Varianten unterscheidet sich das Reblaub der verschiedenen Bewirtschaftungsweisen kaum, mit jeweils vier IOBC-Arten in den Begrünungen überhaupt nicht.
Anders bei den Individuenzahlen. Mit 247 Individuen von IOBC-Arten im Reblaub und 21 Individuen im Unterwuchs der konventionellen Varianten gegen 115 Individuen im Reblaub und 343 Individuen im Unterwuchs der ökologischen Varianten unterscheiden sich die Bewirtschaftungssysteme signifikant.
Als nützliche Wanzenarten im Sinne IOBC, traten vor allem Orius minutus, Nabis pseudoferus und Nabis ferus auf. Mit neun IOBC-Arten in den ökologischen und vier
IOBC-Arten in den konventionellen Varianten unterscheidet sich das Reblaub der verschiedenen Bewirtschaftungsweisen kaum, mit jeweils vier IOBC-Arten in den Begrünungen überhaupt nicht.
Anders bei den Individuenzahlen. Mit 247 Individuen von IOBC-Arten im Reblaub und 21 Individuen im Unterwuchs der konventionellen Varianten gegen 115 Individuen im Reblaub und 343 Individuen im Unterwuchs der ökologischen Varianten unterscheiden sich die Bewirtschaftungssysteme signifikant.
Fazit
Die Untersuchungen zeigten, dass die allgemeine Komplexität der Artengemeinschaft der Wanzen und damit auch das Nützlingspotential innerhalb der Rebflächen durch artenreiche und vielfältige Begrünungen beträchtlich zu erhöhen ist.
Neben den Begrünungsmaßnahmen sind Maßnahmen zur Vernetzung naturnaher Landschaftselemente innerhalb des Rebgeländes anzustreben, da Hecken, Brachen und Trockenmauern als Lebensraum für Nützlinge die bewirtschafteten Nutzflächen übertreffen.
Neben den Begrünungsmaßnahmen sind Maßnahmen zur Vernetzung naturnaher Landschaftselemente innerhalb des Rebgeländes anzustreben, da Hecken, Brachen und Trockenmauern als Lebensraum für Nützlinge die bewirtschafteten Nutzflächen übertreffen.
Exzerpt
"Auswirkungen der Begrünung auf die Wanzenfauna ausgewählter Weinberge Unterfrankens" von Anette Burkholder, Diplomarbeit an der Julius Maximilians Universität Würzburg